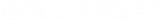Virales Fundraising zu Weihnachten
 Das Weihnachtsgeschenk meiner Eltern an mich war in diesem Jahr ein Schwein. Ein echtes Schwein. Ein virales Schwein sogar. Allerdings: Das Schwein hat mich persönlich nie erreicht. Das ist auch gut so.
Das Weihnachtsgeschenk meiner Eltern an mich war in diesem Jahr ein Schwein. Ein echtes Schwein. Ein virales Schwein sogar. Allerdings: Das Schwein hat mich persönlich nie erreicht. Das ist auch gut so.Man muss wissen: Meine Eltern leben in den USA, auf dem Postweg ist das extrem schwierig mit so einem Schwein, selbst tiefgefroren. Eine Riesensauerei wäre das geworden. Ich bekam stattdessen eine Postkarte, mit einem Schweinefoto darauf, und folgendem Text…
Zunächst verwirrt, erfuhr ich Näheres im Kleingedruckten. Tatsächlich sollte ich selbst kein Schwein erhalten, vielmehr wurde einer bedürftigen Familie irgendwo auf der Welt von einer Hilfsorganisation in meinem Namen ein Schwein als Nutztier geschenkt. Außerdem soll die Familie in der Nutztierhaltung ausgebildet werden, so dass sie künftig besser selbst für ihre Ernährung und ihren Lebensunterhalt sorgen kann. Außerdem – und hier wird’s viral – verpflichtet sich die Familie, eines oder mehrere Ferkel sowie ihr gewonnenes Wissen über die Schweinezucht an andere bedürftige Familien weiterzugeben.
Ich war begeistert. Das war ja Virales Fundraising in Reinform! Ein solches Fallbeispiel hatte ich noch vor einem Jahr verzweifelt gesucht, als ich einen Vortrag für den Deutschen Fundraising-Kongress in Fulda vorbereitete. Seitdem waren mir interessante Beispiele für Virales Fundraising ausschließlich im vergangenen US-Wahlkampf untergekommen.
Da gab es zum einen die „Money Bomb“ des Präsidentschaftsbewerbers Ron Paul. Dieser befand sich zu Beginn seines Wahlkampfes im klassischen Dilemma des Außenseiters: Wer unbekannt ist, hat wenig Zulauf von Spendern, ohne nennenswerten finanziellen Hintergrund wird ein Kandidat aber kaum ernst genommen, er kommt deshalb in den Medien nicht vor und bleibt unbekannt. Ein Teufelskreis also. Ron Pauls Unterstützer kamen deshalb auf folgende Idee: Mithilfe von YouTube und verschiedener Social Networking Sites wurden Ron-Paul-Fans aufgerufen, exakt am 5. November 2007 eine Online-Spende abzugeben. So kamen an diesem einen Tag 4,2 Millionen Dollar zusammen, was nicht nur Pauls Budget erheblich auffüllte, sondern ihm vor allem ein dröhnendes Medienecho und damit kostenlose PR einbrachte.
Weitere Beispiele viralen Fundraisings zeigte – natürlich – Barack Obama, etwas subtiler als Ron Paul, aber nicht weniger effektiv. Dabei sollte sich Obamas strategische Grundentscheidung, sich auf eine große Anzahl von Kleinstspendern zu stützen und nicht auf wenige Großspender, im wahrsten Wortsinn auszahlen. Die Kampagne profitierte zum einen von der Tatsache, dass für kleine Spendenbeträge natürlich ein weitaus größerer Personenkreis als potentielle Spender in Frage kommen, zum anderen von der Erfahrung, dass es Menschen grundsätzlich leichter fällt, nach kleinen Spenden zu fragen als nach großen. Somit konnten viele Obama-Fans selbst als Fundraiser gewonnen werden, die dann in ihrem eigenen Umfeld zusätzliches Geld sammelten. Erleichtert wurde dieser Prozess durch diverse Fundraising-Widgets, die praktisch jedermann auf die eigene Webseite oder Facebook- oder MySpace-Seite platzieren konnte. Allerdings fand das Fundraising keineswegs nur über das Internet statt. Obama entschied sich bewusst für klassische Fundraising-Events, bei denen Unterstützer für ein Eintrittsgeld die Gelegenheit erhalten, ihrem Kandidaten von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Während bei Hillary Clinton und John McCain oft einige Tausend Dollar für ein Veranstaltungsticket gezahlt wurden, konnte man Barack Obama schon für 25 Dollar sehen. Mit diesen Großveranstaltung erreichte Obama mehrere Ziele: Zum einen wuchs seine Unterstützerdatenbank stetig an, da sich jeder Spender mit vollem Namen und Anschrift registrieren lassen muss. Diese Leute konnten jederzeit kontaktiert und womöglich für weitere Aktivitäten rekrutiert werden. Dies umso mehr, als sie sich durch das Live-Erlebnis dem Kandidaten noch stärker verbunden fühlten. Und letztlich blieb das Potential für weitere Geldspenden gigantisch: Während Großspender das gesetzlich zulässige Spendenmaximum von 4.600 Dollar mit einer Spende oft bereits erschöpft hatten, blieb bei den Kleinspender noch viel Luft. (Mehr über das Viral Fundraising von Obama bei TIME.com)
Das waren also die mir bisher bekannten Referenzen erfolgreichen viralen Fundraisings. Die Idee von Heifer International begeistert mich aber noch mehr. Hier liegt das Virale nämlich nicht allein in der Kommunikation, sondern im Spendenakt selbst. Anders gesagt: Bei den Beispielen aus dem Wahlkampf ging es darum, mit den Mitteln der Mundpropaganda eine Menge Lärm zu machen, um von den Medien entdeckt zu werden (Ron Paul) bzw. möglichst viele Leute zum spenden zu aktivieren (Barack Obama). Bei Heifer ist die Spende selbst viral: Auch wenn nur ein einziges Schwein gespendet wird, das viele kleine Ferkelchen wirft, die vielen andere Familien zugute kommen, löst das eine Lawine der Wohltätigkeit aus.
Darüber nachsinnend, saß ich also über die Weihnachtsfeiertage vor meinem Schweinefoto, still begeistert über diese geniale Fundraising-Idee, und summte leise einen alten Tears for Fears-Klassiker vor mich hin. Womöglich bot mein Schwein einer Familie in Not tatsächlich eine echte Perspektive. Allerdings, und das war der Haken, geschah das alles in ziemlich weiter Ferne. Ich selbst hatte nur ein Foto – irgendwie ein recht virtuelles Geschenk.
Am 27. Dezember aber wurde ich doch noch versöhnt. Der Postbote klingelte mit einem Paket von meiner Schwester. Darin ein Gruß aus der Heimat und ihr Weihnachtsgeschenk an mich: Ein Schwein! Und zwar in Gestalt dreier herrlicher Exemplare bester waldhessischer „Ahle Wurscht“. Übrigens auch ein extrem virales Produkt! Doch davon ein andermal.
Foto:
„Pig“ von jere-me via Flickr
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de